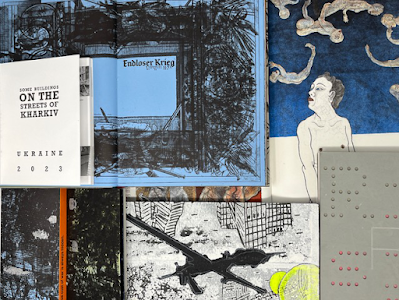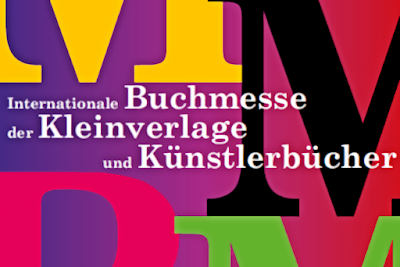Aus Anlass des 200. Stiftungsfestes des
Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig findet im
Deutschen Buch- und Schriftmuseum der
Deutschen Nationalbibliothek im Rahmen des Themenjahres
„Mehr als eine Geschichte. Buchstadt Leipzig“ eine Ausstellung statt.
 |
| Repro: DNB |
Vor 200 Jahren, am 30. April 1825, unterzeichneten 101 Buchhändler und Verleger ihre Börsenordnung, die zugleich die Geburtsstunde des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig war.
Eine der vorrangigen Aufgaben des Börsenvereins war die Organisation eines komplexen Abrechnungsgeschäftes, das aufgrund der verschiedenen Währungen während der Buchmesse entstand. Zweimal im Jahr reisten die auswärtigen Buchhändler in die Buchhandelsmetropole Leipzig. Da ein zentraler Platz für die Abwicklung der Geschäfte fehlte, mietete der Potsdamer Verleger
Carl Christian Horvath von 1797 bis 1824 das Auditorium der theologischen Fakultät, das in der Messezeit nicht benutzt wurde. Später übernahm der Börsenverein die Anmietung der Räumlichkeit. Im Jahr 1836 wurde die Deutsche Buchhändlerbörse in der Ritterstraße eingeweiht.
In den folgenden Jahrzehnten setzte sich sich der Börsenverein gegen Raubdruck und Schleuderpreise ein. 1888 führte der Börsenverein den festen Ladenpreis ein. Darüber hinaus wirkte er an der Gestaltung des Urheberrechts mit. Für den expandierenden Wirtschaftsverband wurde die Buchhändlerbörse bald zu klein, so dass 1888 in der Hospitalstraße (heute Gutenbergplatz) ein repräsentativer Neubau, das Deutsche Buchhändlerhaus, erbaut wurde. Im Dezember 1943 zerstört, befindet sich heute dort das
Haus des Buches, in welchem auch der
Leipziger Bibliophilen-Abend seinen Sitz fand.
Nach 1945 wurde in der damaligen BRD ein eigener
Börsenverein des Deutschen Buchhandels gegründet. Am 1. Januar 1991 wurden beide Börsenvereine mit Sitz in Frankfurt am Main zusammengeschlossen.
Heute sind im
Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V. insgesamt rund 4.000 Verlage, Buchhandlungen und Antiquariate, Zwischenbuchhändler und Verlagsvertreter organisiert.
Anlässlich des 200. Jubiläums erscheint eine
Publikation im Wallstein-Verlag, die unter dem Titel „
Zwischen Zeilen und Zeiten. Buchhandel und Verlage 1825–2025“ in über 200 kurzen Essays eine andere Geschichte des Börsenvereins erzählt.
Eröffnung: Mittwoch, 23. April 2025, 18 Uhr, Begrüßung: Dr. Stephanie Jacobs, Leiterin des Deutschen Buch- und Schriftmuseums, Grußwort: Peter Kraus vom Cleff, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
Ausstellung: 24. April - 15. Dezember 2025
Deutsche Nationalbibliothek
Deutsches Buch- und Schriftmuseum
Deutscher Platz 1, 04103 Leipzig